Wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Forschung
CMS Stiftung News · 2. Juli 2025

Seit anderthalb Jahren forschen Mitarbeitende am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zum Thema „Zugang zum Recht auf Gewaltschutz“, gefördert von der CMS Stiftung. Die Hälfte der Zeit ist nun um. Zum Auftakt in die zweite Phase hat die Stiftung die Forschenden mit Vertreter:innen aus Beratungsstellen zusammengebracht. Ein Halbzeit-Gespräch mit Co-Projektleiterin Paula Edling.
Wenn bei einem sportlichen Wettkampf Halbzeit ist, heißt es für Spieler:innen und Coaches meistens, kurz durchzuatmen, die erste Hälfte zu analysieren und eventuell einen angepassten Plan für die zweite Hälfte zu entwerfen. Gar nicht so erstaunlich, dass es bei manchen Forschungsvorhaben nicht viel anders ist – etwa beim ersten wissenschaftlichen Projekt, das die CMS Stiftung fördert und das Anfang 2024 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) bei Prof. Dr. Michael Wrase gestartet ist. Das Thema: „Zugang zum Recht auf Gewaltschutz.“
Der Übergang in die zweite Phase des auf drei Jahre angelegten Projekts ist fließend: Standen in der ersten Phase statistische Auswertungen und Aktenanalysen im Mittelpunkt, wendet sich das Team um Projektleiterin Paula Edling nun dem Vorfeld der Justiz zu. Den Auftakt bildete Mitte Juni ein Workshop bei CMS Deutschland in Hamburg, zu dem die CMS Stiftung die WZB-Verantwortlichen sowie elf Vertreter:innen aus zehn durch die Stiftung geförderten Beratungsstellen in Hamburg und Schleswig-Holstein eingeladen hatte. Ganz nach dem Motto: Wissenschaft meets Praxis. „Wir wollten damit einen möglichst ganzheitlichen Blick aufs Thema ermöglichen“, sagt Stefanie Wismeth, die Geschäftsstellenleiterin der CMS Stiftung. „Wir kommen damit hoffentlich einen Schritt näher an praxistaugliche, wirksame Verbesserungen.“
Paula Edling hat sich bereits mit dem Thema geschlechtsspezifischer Gewalt in verschiedenen Kontexten auseinandergesetzt und verfasst derzeit dazu ihre Doktorarbeit.

Frau Edling, Sie haben sich tief in das seit 2002 gültige Gewaltschutzgesetz und seine Praxistauglichkeit eingearbeitet. Worum geht es in diesem Gesetz?
Paula Edling: Im Kern ist es ein Instrument für Betroffene von Gewalt, um sich selbstbestimmt wehren zu können, ohne gleich ein langwieriges Strafverfahren einleiten zu müssen. Sie können bei Gericht einfordern, vorübergehend von dem Täter oder der Täterin in Ruhe gelassen zu werden, um ihr Leben selbstbestimmt weiterführen und auch die gemeinsame Wohnung zugeteilt bekommen zu können. Trotzdem wird dieses Instrument von nur wenigen Betroffenen Anspruch genommen. Eine wichtige Beobachtung bei der Frage nach dem Grund war, dass in Gerichten zwei Welten aufeinanderprallen.
Wie meinen Sie das?
Da wenden sich gewaltbetroffene Menschen an Gerichte und stoßen dort auf ein stark juristisch formalisiertes System. Diese Übersetzungsleistung ist schon in vielen anderen rechtlichen Kontexten nicht leicht, in diesem Kontext ist sie aber besonders schwierig. Menschen, die gerade Gewalt erfahren haben, verfügen in solchen Momenten häufig weder über Ressourcen noch Kapazitäten, um das leisten zu können. Da bedarf es einer anderen Unterstützung.
Umso wichtiger ist Ihre Forschung. In der ersten Projekt-Halbzeit haben Sie Daten und Akten ausgewertet. Was kam dabei heraus?
Erstmal haben wir uns angeschaut, wie ein solches Verfahren überhaupt aussieht, also wer ins Gericht kommt und das Verfahren durchläuft. Dafür haben wir vom Kammergericht Berlin die anonymisierten Daten aller Gewaltschutzverfahren bekommen, die in Berlin in den vergangenen achteinhalb Jahren geführt wurden. Darin konnten wir beispielsweise sehen, an welchem Gericht in welchem Zeitraum welche Verfahren liefen und wie sie ausgegangen sind. Allerdings waren die Strukturdaten aus wissenschaftlicher Sicht oft unzureichend, sie werden aber ja auch nicht primär für die Forschung erhoben. Vor allem sagen sie aber nichts darüber aus, wie das Verfahren ablief.
Daher dann Aktenstudium?
Genau. Nach monatelangem Vorlauf – Stichwort Datenschutz – haben wir an allen vier Berliner Familiengerichten, an denen Gewaltschutzverfahren durchgeführt werden, jeweils um die 90 Akten sichten können. Am Ende haben wir 123 Akten anonymisiert mitgenommen, die uns jetzt vertiefende Einblicke liefern: Was ist da genau passiert und wie sah das Verfahren aus? Wie wurde argumentiert und das Gesetz angewandt? Und warum kam es zu genau diesem Verfahrensausgang und nicht zu einem anderen?

Was hat Sie in dieser ersten Phase am meisten überrascht?
Wie wenig Anträge zunächst überhaupt gestellt, aber vor allem wie wenig davon am Ende auch bewilligt werden. Laut polizeilicher Kriminalstatistik erleben pro Jahr bis zu 13.000 Menschen partnerschaftliche Gewalt, es werden aber nur 2.000 Gewaltschutzanträge gestellt – und das Dunkelfeld ist natürlich noch viel, viel größer. Für diese spezifische Zielgruppe scheint es also viele Gründe zu geben, das Verfahren nicht in Anspruch zu nehmen oder andere Strategien zu wählen.
Und wie erfolgreich sind die Gewaltschutzanträge?
Laut unserer Untersuchung zu 40 Prozent. Das kann man auf den ersten Blick im Vergleich zu anderen Verfahren nicht überraschend finden. Aber: Die Idee dieses Verfahrens ist ja, einer gewaltbetroffenen Person schnell einen niedrigschwelligen Schutz zu bieten, wenn sie Gewalt befürchtet. Die Gegenseite muss zum Beispiel gar nicht gehört werden, sodass das Verfahren sehr unproblematisch und zügig durchlaufen werden kann. Dafür sind 40 Prozent nicht viel.
Woran liegt das?
Es gibt viele Gründe. Die Richter:innen folgen formalisierten juristischen Kriterien bei der Prüfung, ob eine Anordnung erteilt werden kann. Wenn bei Anträgen bestimmte formale, aber auch inhaltliche Aspekte nicht berücksichtigt wurden, dann wird es schwierig. Wenn man sich aber mit Gewalterleben auseinandersetzt, dann weiß man, dass sich die betroffenen Menschen in einer Ausnahmesituation befinden – Abhängigkeiten, Ängste, Traumata – die genau die Erfüllung dieser Ansprüche erschwert. Da prallen zwei Logiken aufeinander.
Braucht es in solchen Fällen die Berater:innen und Anwält:innen?
Das wurde mir beim Workshop mit der CMS Stiftung klar:
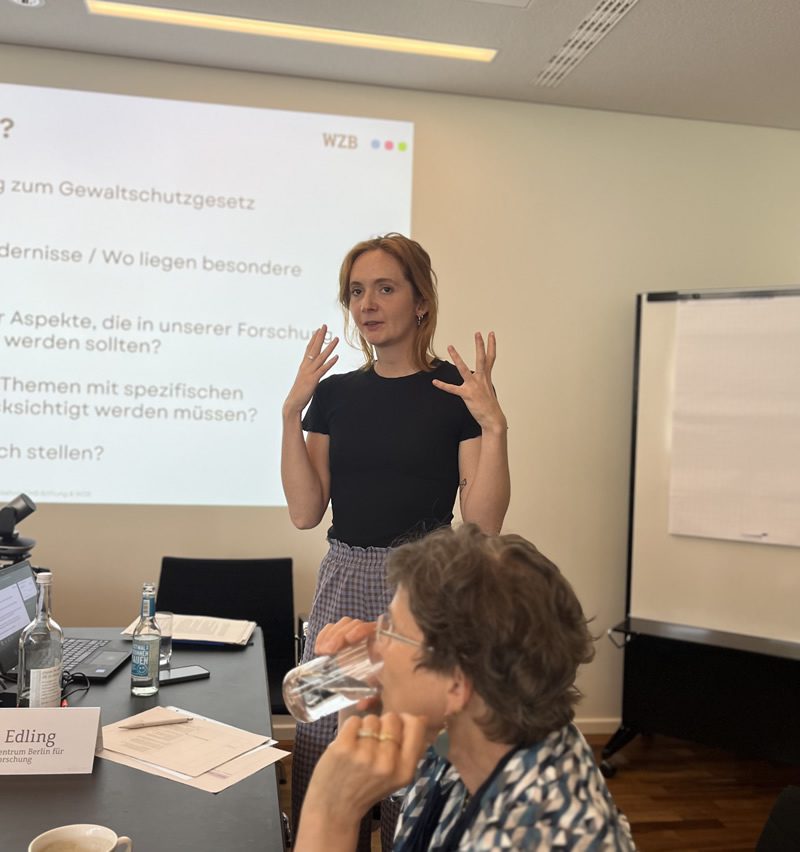
„Berater:innen und Anwält:innen haben eine äußerst wichtige Scharnierfunktion, damit Anträge erfolgreich sein können.“ (Paula Edling)
Der Workshop hatte also einen Mehrwert für Sie?
Absolut. Ich wollte unbedingt während des Forschungsprozesses mit Menschen aus der Praxis zusammenkommen und erfahren, ob unsere Forschung aus deren Sicht überhaupt sinnvoll ist und wie sie diese beurteilen.
Und?
Es war schön zu hören, dass unser Projekt und unser Vorgehen auf Resonanz stoßen. Wir untersuchen zahlreiche Aspekte, die auch in der Beratungspraxis immer wieder relevant sind. Zudem war es interessant zu erfahren, wie die alltägliche Beratungsarbeit abläuft und welche Abwägungen bei einer Beratung getroffen werden. In den Akten sehen wir nicht, wie ohnmächtig und unfähig sich Betroffene oft fühlen, da ihre Perspektive kaum vorkommt. Die Berater:innen haben erzählt, wie viele sich häufig nicht in der Lage fühlen, rechtliche Schritte zu gehen, schon der Gang zur Beratungsstelle ist sehr schwer.

„In der Forschung können wir noch so viel annehmen, aber es ist immer von hohem Wert, sich mit Menschen aus der Praxis auszutauschen. (Paula Edling)“
Welche Erkenntnisse haben Sie in dem Austausch gewonnen?
Ein Beispiel ist die Wohnungsproblematik: Wenn nach dem Gewaltschutzgesetz die Wohnung dem Opfer zugesprochen wird, kann der Täter von einem Moment auf den anderen wohnungslos werden – insbesondere, wenn es keine Alternativen wie spezielle Unterkünfte für Täter:innen gibt.
„Das Gesetz liefert auch für Menschen in Schutz- und Gemeinschaftsunterkünften oder in Pflegeeinrichtungen häufig keine passenden Antworten.“ (Teilnehmerin aus Beratungsstelle)

Haben Sie darüber gesprochen, was sich sonst konkret ändern müsste?
Grundsätzlich wollen wir auf Basis unserer Forschung gemeinsam mit der CMS Stiftung konkrete Vorschläge liefern, was nun zu tun ist. Deshalb bin ich für diese Expert:innenrunde so überaus dankbar. Denn dort habe ich Antworten auf meine Überlegungen bekommen, die ich mir hinter meinem Schreibtisch gemacht habe und von denen ich nicht wusste, ob sie überhaupt praxistauglich sind.
Was würden Sie nach dem derzeitigen Stand vorschlagen?
Zuallererst Fortbildungen von Richter:innen in diesem Gebiet über Gewalt und Sensibilisierung aller, die an solch einem Verfahren beteiligt sind, um den Betroffenen in ihrer schwierigen Lebenssituation gerecht zu werden. Das entspricht auch den Forderungen der Beratungsstellen seit Jahren. Zudem werden aktuell Gesetzesänderungen diskutiert, das Gesetz um die Anwendung der elektronischen Fußfessel zu erweitern und eine verpflichtende Täterarbeit einzuführen, bei der sich die Täter:innen intensiv mit ihrem Handeln auseinandersetzen müssen. Diese Erweiterungen sind durchaus als sinnvoll zu betrachten. Besonders die verpflichtende Täterarbeit finde ich relevant, um weiteres Gewalthandeln präventiv zu verhindern. Allerdings können solche Maßnahmen nie alleine erfolgen, sondern müssen immer zusammen mit einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung von Gewalt gedacht werden, die bereits im Schulsystem beginnt. Das haben übrigens auch die Expert:innen beim Workshop gefordert.
Hat der Workshop Sie für bestimmte Aspekte sensibilisiert?
Auf jeden Fall. Es sind Aspekte aufgetaucht, die ich sehr spannend finde und die wir als Fragen mitgenommen haben, auch rechtliche Fragen. Heute im Institut haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, ob das Gericht bei der Antragstellung eine Übersetzung ermöglichen muss oder erst bei einer Verhandlung. Oder die Erkenntnis, dass es im ländlichen Raum einen Mangel an Jurist:innen gibt, die sich dieses Themas annehmen. Darüber hinaus ist diese Runde auch deshalb von hohem Wert, weil wir darüber Kontakte zu Betroffenen für weitere Interviews bekommen können. Ich bin der CMS Stiftung wirklich dankbar, dass sie diese wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis geschlagen hat.
Gibt es ein Folgetreffen?
Das würde ich mir in jedem Fall wünschen.
